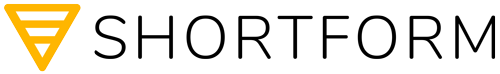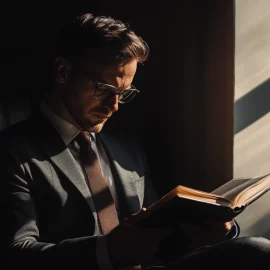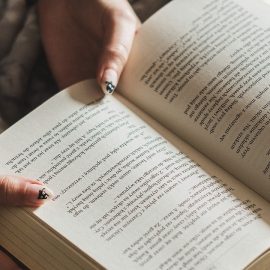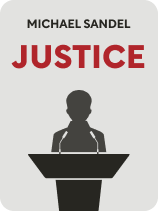
Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Shortform Buchführer zu "Justice" von Michael Sandel. Shortform hat die weltweit besten Zusammenfassungen und Analysen von Büchern, die Sie lesen sollten.
Gefällt Ihnen dieser Artikel? Melden Sie sich hier für eine kostenlose Testversion an.
Worum geht es in Michael Sandels Justice? Was ist die wichtigste Botschaft, die man aus dem Buch mitnehmen kann?
Gerechtigkeit ist Michael Sandels Erkundung der philosophischen Perspektiven auf Gerechtigkeit und Moral. Zu diesem Zweck untersucht Sandel, wie Philosophen im Laufe der Jahrhunderte politische Dilemmas mit ethischen Implikationen angegangen sind, und bietet dabei seine eigene Kritik an.
Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über Justice: What's the Right Thing to Do? von Michael Sandel.
Teil 1: Wohlfahrt versus Freiheit
In Gerechtigkeit: What's the Right Thing to Do? erörtert Sandel die Rolle des Staates, indem er ein gängiges Thema der politischen Debatte skizziert: Inwieweit sollte der Staat persönliche Freiheiten einschränken, um die öffentliche Sicherheit und das Wohlergehen zu gewährleisten? Er veranschaulicht diese Debatte, indem er zwei radikal unterschiedliche Ideologien vergleicht:
- Utilitarismus, eine Philosophie, die der Meinung ist, dass die Regierung sich nur um die Maximierung des öffentlichen Wohls kümmern sollte
- Libertarismus, eine Philosophie, die der Meinung ist, dass die Regierung sich nur um die Maximierung der persönlichen Freiheiten kümmern sollte
In Teil 1 unseres Leitfadens werden wir uns mit Sandels Beschreibung dieser beiden Philosophien befassen und untersuchen, wie sich ihre Ansichten auf reale politische Fragen anwenden lassen.
Maximierung der Wohlfahrt: Der Utilitarismus
Sandel beginnt mit der Erörterung des Utilitarismus - einer Moralphilosophie, die argumentiert, dass die Moral einer Handlung oder Entscheidung davon abhängt, wie viel Glück oder Schmerz sie erzeugt. "Glück" bedeutet für Utilitaristen (die sie "Nutzen" nennen) Vergnügen und die Erfüllung von Wünschen, während ein Mangel an Glück Schmerz oder den Entzug von Wünschen bedeutet. Utilitaristen argumentieren, dass Glück und Schmerz die einzigen Möglichkeiten sind, Moral zu messen - moralischgute Dinge machen Menschen glücklich, während moralisch schlechte Dinge Menschen Schmerzen verursachen. Daher besagt der Utilitarismus, dass die moralischste Entscheidung in einer gegebenen Situation immer diejenige ist, die für die meisten Menschen das größtmögliche Glück bringt.
Um zu zeigen, wie sich dies auf politische Fragen auswirkt, untersucht Sandel zwei wichtige Ansichten, die sich aus dem utilitaristischen Denken ergeben: dass es keine garantierten individuellen Rechte gibt und dass wir Glück messen können.
Ansicht #1: Keine garantierten individuellen Rechte
Nach Ansicht der Utilitaristen, Individuen aus moralischer Sicht keine garantierten Grundrechte - wie das Recht auf Sicherheit, Freiheit oder Eigentum. Stattdessen glauben Utilitaristen nur an die Gewährung dieser Rechte, wenn dadurch das kollektive Glück maximiert wird. Andererseits ist es moralisch gerechtfertigt, einem Individuum zu schaden oder es seiner Freiheit zu berauben, wenn dies das kollektive Glück maximiert.
Der englische Philosoph und Begründer des Utilitarismus Jeremy Bentham (1748-1832) vertrat beispielsweise die Ansicht, dass Regierungen Obdachlose zusammentreiben und in Arbeitslagern einsperren sollten. Er behauptete, dass dies moralisch sei, weil es mehr Nutzen (billige Arbeitskräfte zur Senkung der Warenkosten, weniger Obdachlose auf der Straße, Verbesserung des Lebensstandards für Obdachlose) als Schmerz (Freiheitsentzug für Obdachlose) bringe.
Ansicht Nr. 2: Menschen können Glück messen
Um zu verstehen, wie viel Glück oder Schmerz eine Handlung verursacht (ein entscheidender Teil der Bestimmung, was am ethischsten ist), glaubt ein Utilitarist, dass er das Glück auf einer einheitlichen Skala messen kann. Sandel erklärt zwei Hauptperspektiven, wie man dies tun kann:
1) Quantitative Methode: Einige Utilitaristen (einschließlich Bentham) bewerten bei der Messung des Glücks alle Vergnügen gleich. Dieser nicht wertende Ansatz macht es einfacher, Vergnügen und Schmerz zu messen - sie berücksichtigen nur, wie viele Vergnügen eine Entscheidung hervorruft, und nicht, welche Vergnügen geringer oder größer sind. Bei einer quantitativen Methode würde zum Beispiel das Vergnügen, die Mona Lisa zu betrachten, dem Vergnügen gleichgestellt, die Real Housewives of New Jersey zu sehen.
2) Qualitative Methode: Andere Utilitaristen wie John Stuart Mill (1806-1873) plädieren für eine Hierarchie der Vergnügungen , anstatt sie alle gleich zu bewerten. Sie gehen davon aus, dass ein allgemeiner Konsens diese Hierarchie schaffen kann - wenn die Menschen allgemein darin übereinstimmen, dass eine Vergnügung besser ist als eine andere (wobei sie sich darauf konzentrieren, was sie tatsächlich mögen, und nicht darauf, was sie denken, dass sie mögen sollten ), dann wird die Gesellschaft diese Vergnügung höher bewerten. Wenn die Menschen zum Beispiel allgemein akzeptieren, dass ihnen The Real Housewives of New Jersey besser gefällt als die Mona Lisa oder dass es sich um "bessere Kunst" handelt, dann würde eine qualitative Skala die Real Housewives höher bewerten als die Mona Lisa.
Maximierung der Freiheit: Libertarismus
Sandel stellt dem Utilitarismus dann eine ganz andere Sichtweise gegenüber: den Libertarismus, eine politische Philosophie, die das Ziel des Staates in der Maximierung der persönlichen Freiheit sieht. Dieses Ziel ergibt sich aus der libertären Überzeugung, dass die Menschen sich selbst besitzen. Dies mag zwar abstrakt klingen, doch in der Praxis argumentieren die Libertären damit für zwei Arten von Freiheit:
- Persönliche Freiheit: Die Menschen haben die Freiheit, ihr eigenes Leben so zu gestalten und zu beeinflussen, wie sie es für richtig halten. Dies ist im Wesentlichen dasselbe wie die Freiheit, sein Eigentum nach Belieben zu nutzen - da man sich selbst besitzt, kann man sich "benutzen", um so zu leben, wie man will.
- Wirtschaftliche Freiheit: Die Menschen sind Eigentümer ihrer Arbeit und dessen, was sie schaffen. Wenn Sie zum Beispiel einen Zitronenbaum besitzen, gehören Ihnen auch die Zitronen, die er wachsen lässt. Ähnlich verhält es sich, wenn man sich selbst besitzt, dann gehört einem auch, was man tut und schafft.
Sandel skizziert diese beiden Formen der Freiheit und wie sie politische Fragen beeinflussen:
Persönliche Freiheit
Sandel erklärt, dass Libertäre zum Schutz der persönlichen Freiheit vor allem zwei Arten von Gesetzen ablehnen:
1) Sicherheitsgesetze: Da jeder Mensch sich selbst besitzt, hat er das Recht, persönliche Risiken einzugehen, wenn er dies möchte. Die Libertären argumentieren, dass Sicherheitsgesetze diese Freiheit einschränken und daher unethisch sind. Beispiele für solche Gesetze sind die Kriminalisierung von potenziell gefährlichen Substanzen wie Heroin oder auch banalere Regeln wie Geschwindigkeitsbegrenzungen.
2) Moralische Gesetze: Da jeder Mensch sich selbst besitzt, hat er ein Recht darauf, nach seinem eigenen Moralkodex zu leben. Daher glauben Libertäre, dass Gesetze, die einen bestimmten Moralkodex durchsetzen, unethisch sind. Libertäre lehnen zum Beispiel Gesetze gegen Homosexualität oder Abtreibung ab - sie sind der Meinung, dass Menschen ein Recht auf moralische Überzeugungen haben, die gegen Homosexualität oder Abtreibung gerichtet sind, dass es aber unethisch ist, die Freiheit derjenigen einzuschränken, die andere Ansichten vertreten.
Wirtschaftliche Freiheit
Sandel sagt, dass Libertäre, um das persönliche Eigentum an der Arbeit und allem, was sie schafft, zu bewahren, auch die meisten wirtschaftlichen Regulierungen ablehnen. Insbesondere sprechen sie sich gegen die Umverteilung von Reichtum aus - von höheren Steuern für Reiche bis hin zu einem staatlich verordneten Mindestlohn. Libertäre argumentieren, dass die Umverteilung von Reichtum im Grunde genommen Diebstahl ist: Die Regierung nimmt sich gewaltsam Geld, auf das die Menschen ein Recht haben. Einige argumentieren sogar, dass die Umverteilung von Reichtum mit Zwangsarbeit gleichzusetzen ist, da der Staat sich das Ergebnis der Arbeit eines Menschen gewaltsam aneignet .
Der libertäre Staat
Obwohl Libertäre der Meinung sind, dass der Staat die Freiheit maximieren sollte, erkennen sie an, dass es die Aufgabe des Staates ist, Menschen daran zu hindern, die Freiheit anderer einzuschränken. Daher braucht der ideale libertäre Staat einige Gesetze und Regierungsstrukturen. Insbesondere argumentieren Libertäre, dass der Staat individuelle Handlungen, die die Freiheit anderer einschränken, wie Diebstahl oder Mord, unter Strafe stellen muss. Er sollte auch Verträge durchsetzen und Betrug bestrafen, um sicherzustellen, dass die Menschen ihr Eigentum und ihre Arbeitskraft so nutzen können, wie sie es wollen.
Teil 2: Vernunft versus Tugend
Das zweite Dilemma, das Sandel erörtert, ist die Frage, ob die Regierung eine bestimmte Auffassung von Moral vertreten oder die Durchsetzung eines bestimmten Moralkodex vermeiden sollte. Um dieses Dilemma zu erkunden, betrachtet er erneut zwei gegensätzliche Philosophien:
- Liberalismus: eine Philosophie, die moralische Fragen zugunsten von Vernunft und Logik vernachlässigt
- Die politische Theorie des Aristoteles: eine Philosophie, die moralische Fragen als entscheidend für die Politik betrachtet
In diesem Abschnitt werden wir Sandels Beschreibung dieser beiden Philosophien erörtern und erörtern, wie sie in reale politische Debatten und Entscheidungen einfließen könnten.
Maximierung der Vernunft: Der Liberalismus
Zunächst beschreibt Sandel den Liberalismus und seine Betonung der Vernunft. Diese Schule der politischen Philosophie entwickelte sich während der Aufklärung (einer Zeit des raschen wissenschaftlichen und ideologischen Wandels im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts) und hat auch heute noch großen Einfluss auf viele unserer politischen Institutionen.
Sandel erklärt, dass der Liberalismus versucht, die Politik von den persönlichen Hintergründen, Identitäten und moralischen Überzeugungen der Menschen zu trennen. Stattdessen argumentieren Liberale, dass Menschen Logik und Vernunft nutzen sollten, um über Politik, Recht und Gerechtigkeit zu diskutieren. Ähnlich wie die Libertären (ein Ableger der liberalen Tradition) plädieren die Liberalen für einen "wertneutralen" Staat, der es vermeidet, einen bestimmten Moralkodex gegenüber einem anderen zu bevorzugen, und den Menschen die Freiheit lässt, ihr Leben so zu leben, wie sie es für richtig halten. Zu diesem Zweck unterstützt der Liberalismus die Redefreiheit, die Trennung von Kirche und Staat und universelle Gesetze, die für alle Menschen unabhängig von ihrer Identität, ihrem Hintergrund oder ihrem Glauben gleichermaßen gelten.
Sandel erörtert zwei Philosophen, die die klassischen und modernen Ansichten des Liberalismus vertreten: den deutschen Philosophen Immanuel Kant aus dem 18. Jahrhundert und den amerikanischen Philosophen John Rawls aus dem 20.
Klassischer Liberalismus: Kantianismus
Kants moralische und politische Ansichten betonen die Vernunft über alles. Sandel erklärt, dass nach Kant Handlungen nur dann moralisch sind, wenn man sich durch rein rationale Überlegungen für sie entscheidet. Kant argumentiert, dass man eine Entscheidung, die man nicht ausschließlich mit der Vernunft trifft, aufgrund angeborener Instinkte und Vorlieben trifft - Dinge, über die man keine Kontrolle hat. Daher wurde diese Entscheidung nicht frei getroffen.
Wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Job arbeiten, um Geld für Lebensmittel und eine Wohnung zu verdienen, dann argumentiert Kant, dass Ihre Entscheidung, zu arbeiten, nicht frei gewählt und daher keine moralische Handlung ist - sie ist nicht durch Ihre rein rationale Sichtweise dessen, was moralisch am besten ist, motiviert, sondern vielmehr durch Ihren Selbsterhaltungstrieb, Nahrung und Unterkunft zu suchen.
Kant erklärt, dass man, um eine moralische Entscheidung frei treffen zu können, pflichtbewusst und bedingungslos einem moralischen Gesetz gehorchen muss , das man für sich selbst geschaffen hat. Oder einfacher ausgedrückt: Man muss das, was moralisch ist , nur tun, weil es moralisch richtig ist, und nicht aus anderen Gründen.
Kant argumentiert, dass moralische Gesetze zwei Standards erfüllen müssen, um vollkommen rational zu sein (der so genannte "kategorische Imperativ"):
1) Moralische Gesetze müssen universell funktionieren. Um zu prüfen, ob ein moralisches Gesetz ausschließlich auf der Vernunft beruht, sollte man sich überlegen, wie es funktionieren würde, wenn jeder es befolgen würde. Wenn es nicht universell funktioniert, dann basiert es zumindest teilweise auf persönlichen Vorlieben und nicht ausschließlich auf der Vernunft. Ein Beispiel: John ist wütend über seinen lästigen Nachbarn und denkt: "Ich sollte Leuten wehtun, die mich nicht respektieren." Wenn jedoch jeder dieses Gesetz pflichtbewusst befolgen würde, gäbe es massive und andauernde Zyklen der Gewalt. Daher basiert Johns Gesetz auf Vorlieben und ist nicht moralisch.
2) Moralische Gesetze können rationale Wesen nicht als Mittel zum Zweck benutzen. Wie bereits erläutert, hat ein moralisches Gesetz, das man um seiner selbst willen befolgt, einen inhärenten Wert - man befolgt es, weil es das moralisch Richtige ist, und nicht, weil es einem etwas anderes bringt. Kant argumentiert, dass das menschliche Leben genauso ist: Vernünftige Menschen leben das Leben um seiner selbst willen und nicht für ein anderes äußeres Ziel. Und da wir nur leben, um am Leben zu sein, muss das Leben einen inhärenten Wert haben. Daher ist Kant der Ansicht, dass moralische Gesetze den Eigenwert des menschlichen Lebens respektieren müssen. Das bedeutet, das menschliche Leben als Selbstzweck anzuerkennen und andere (oder sich selbst) nicht als Mittel zum Zweck zu benutzen.
John möchte zum Beispiel seinen lästigen Nachbarn verprügeln. Wenn er das täte, würde er seinen Nachbarn jedoch als Mittel zum Zweck benutzen, um seine Wut loszuwerden und sich selbst besser zu fühlen. Daher ist es nach dem kategorischen Imperativ unmoralisch, wenn John seinen Nachbarn schlägt.
Moderner Liberalismus: Rawlsianismus
Als zeitgenössisches Beispiel für den Liberalismus erörtert Sandel den amerikanischen Philosophen John Rawls aus dem 20. Rawls verfolgt zwar dasselbe Ziel wie Kant - Gerechtigkeit ausschließlich durch Vernunft zu definieren -, geht aber auf andere Weise vor. Anstatt an universelle moralische Gesetze zu appellieren, konzentriert sich Rawls ganz darauf, wie eine Gruppe von gleichermaßen kompetenten und völlig rationalen Individuen die Gesellschaft organisieren würde. Diese Organisation würde die Verteilung von Vorteilen (Reichtum, politische Macht, Rechte) und Pflichten (Gesetze, Erwartungen) bestimmen. Im Wesentlichen versucht Rawls, Gerechtigkeit so zu definieren, dass seiner Meinung nach jeder rationale und eigennützige Mensch damit einverstanden sein könnte.
Zu diesem Zweck entwirft Rawls ein Gedankenexperiment, das er "die ursprüngliche Position" nennt . In der ursprünglichen Position kommen alle als rationale, eigennützige Gleiche zusammen, um über die Definition von Gerechtigkeit zu debattieren, bis sie eine finden, mit der alle einverstanden sind. In diesem hypothetischen Fall kennen die Menschen ihre spezifischen Lebensumstände nicht - Dinge wie Reichtum, Religion, Ethnie, Sexualität und so weiter. Das bedeutet, dass die Menschen für Bedingungen argumentieren, die für alle Menschen unabhängig von ihren Lebensumständen gelten. In der ursprünglichen Position weiß Tom beispielsweise nicht, wie wohlhabend er ist. Daher wird er sich nicht für Bedingungen einsetzen, die den Reichen auf Kosten der Armen zugute kommen - er weiß nur, dass er arm ist (oder arm werden könnte).
Rawls schlägt vor, dass die ursprüngliche Position zu zwei Begriffen (oder etwas Ähnlichem) führt:
- Jeder Mensch hat garantierte individuelle Grundrechte.
- Ungleichheiten in Bezug auf Macht und Geld können bestehen, aber nur, wenn sie den weniger Glücklichen (und vor allem den am wenigsten Glücklichen) zugute kommen.
Begriff eins stellt sicher, dass niemand unterdrückt wird oder ihm Freiheiten zum Wohle anderer vorenthalten werden. Begriff zwei stellt sicher, dass Menschen sozial oder wirtschaftlich vorankommen können, aber nicht auf Kosten des Leidens anderer Menschen. Ähnlich wie Kant sind Rawls' Regeln universell - er glaubt, dass sie jede politische Frage gerecht lösen können.
Maximierung der Tugend: Die politische Theorie des Aristoteles
Sandel stellt dem Liberalismus die politische Theorie von Aristoteles, dem athenischen Philosophen aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., gegenüber. Im Gegensatz zu liberalen Philosophen ist Aristoteles der Ansicht, dass wir die Politik nicht von Fragen der Moral und der persönlichen Lebensumstände trennen können und sollten. Um zu zeigen, warum dies der Fall ist, konzentriert sich Sandel auf zwei Hauptthemen von Aristoteles' Sichtweise:
Thema Nr. 1: Teleologie und Gerechtigkeit
Aristoteles hat eine "teleologische" Sicht der Welt - mit anderen Worten, er glaubt, dass alles ein Endziel oder einen Zweck ( telos im Altgriechischen) hat. Sandel erklärt, dass Aristoteles diese Sichtweise verwendet, um die Politik als Ganzes sowie die Beziehung zwischen Politik und Individuum zu erklären:
1) Das telos der Politik ist es nach Aristoteles, Gesetze und eine Gesellschaft zu schaffen, die den Menschen helfen, ein zufriedenstellendes und tugendhaftes Leben zu führen. Während der Liberalismus darauf abzielt, den Menschen die Möglichkeit und die Freiheit zu geben , gut zu leben und moralisch zu sein , wenn sie sich dafür entscheiden, glaubt Aristoteles, dass es keine Wahl geben sollte.
2) Aber die Definition von "gut leben" variiert je nach Person, erklärt Aristoteles - verschiedeneArten von Menschen haben ihre eigenen unterschiedlichen telos (Lebensziele) und benötigen unterschiedliche Dinge, um sie zu erreichen.
Stellen Sie sich zum Beispiel jemanden vor, der orientierungslos ist und in der Gesellschaft nicht allein zurechtkommt. Für Aristoteles hätte diese Person das Telos des Gehorsams - um zu gedeihen und das bestmögliche Leben zu führen, bräuchte sie Führung, Aufsicht und Hilfe von einem Vorgesetzten. Aristoteles sagt, dass in diesem Fall die Versklavung dieser Person moralisch ist - sie hilft sowohl der versklavten Person als auch dem Versklavenden. Wenn die versklavte Person jedoch ihren Status ablehnt oder versucht zu fliehen, dann sollte sie nach Aristoteles frei sein, da ihre Ablehnung zeigt, dass sie nicht das Telos hat, versklavt zu sein.
Thema Nr. 2: Führungspersönlichkeiten mit Verdienst
Der zweite wichtige Teil von Aristoteles' politischer Theorie, den Sandel erörtert, hat mit Verdienst und "Verdienst" (ein philosophischer Begriff, der "etwas verdienen" bedeutet) zu tun. Dies sind die wichtigsten Leitlinien, die Aristoteles für die Verteilung sozialer Güter wie Rechte, Reichtum und politische Macht verwendet. Er argumentiert, dass die Gesellschaft die Güter denjenigen geben sollte, die sie am besten gebrauchen können -zum Beispiel die besten Werkzeuge dem besten Schreiner oder das meiste Land den besten Bauern. Da Aristoteles die Politik als Anwendung der Tugend betrachtet, kommt er zu dem Schluss, dass die tugendhaftesten Menschen die Macht haben sollten. Dies steht im Zusammenhang mit dem Telos der Politik: Da das Ziel der Politik darin besteht, die Menschen dazu zu bringen, tugendhaft zu leben, folgt daraus, dass eine tugendhafte Person am besten für diese Aufgabe geeignet ist.
Für Aristoteles findet dies alles im Kontext einer Gemeinschaft als Ganzes statt - der beste Bauer würde nicht das meiste Land bekommen, nur um seinen persönlichen Reichtum zu vergrößern. Stattdessen würde dieser Bauer seine Fähigkeiten nutzen, um Lebensmittel für alle in der Gemeinschaft anzubauen.
Teil 3: Wie man vorwärts kommt
Sandel schließt das Buch mit seiner eigenen Vorstellung von Gerechtigkeit und der Frage, wie seiner Meinung nach eine moralischere Welt geschaffen werden kann. Er plädiert für eine Version des Kommunitarismus (eine Philosophie, die davon ausgeht, dass es das Ziel des Staates ist, eine Gemeinschaft von Bürgern zu schaffen und zu erhalten), die das öffentliche Engagement, die Verwandtschaft zwischen den Bürgern und das Gefühl, Teil eines größeren Projekts zu sein, fördert. In diesem Abschnitt werden wir die Vorteile von Sandels Ansatz sowie einige praktische Beispiele, die er für dessen Umsetzung vorschlägt, untersuchen.
Vorteile des Kommunitarismus
Sandel argumentiert, dass seine Version des Kommunitarismus die besten Teile der von ihm diskutierten Philosophien vereint, während er die moralisch bedenklichen Teile vermeidet:
Utilitarismus: Sandels Ansicht teilt die utilitaristische Sorge um das allgemeine öffentliche Wohl, indem er sich auf den Dienst an der Gemeinschaft als Ganzes konzentriert. Im Gegensatz zum Utilitarismus sieht Sandels Philosophie den Einzelnen jedoch als inhärent wertvolles Mitglied der Gemeinschaft an, unabhängig von Vergnügen oder Schmerz.
Libertarismus: Ähnlich wie die Libertären schätzt Sandel die Vorteile des freien Marktes als Instrument zur Organisation und Schaffung von Wohlstand. Er glaubt auch, dass der Staat bis zu einem gewissen Grad die persönlichen Freiheiten respektieren sollte. Sandel plädiert jedoch nicht für eine vollständige Deregulierung dieser Bereiche. Stattdessen vertritt er die Ansicht, dass der Staat das persönliche Verhalten und den Markt steuern und regulieren sollte, um sicherzustellen, dass sie der Gemeinschaft als Ganzes dienen.
Liberalismus: Ähnlich wie liberale Philosophen plädiert Sandel für ein Grundniveau von Anstand, Respekt und persönlichen Rechten für alle Menschen. Er widerspricht jedoch der liberalen Auffassung, dass sich diese grundlegenden moralischen Verpflichtungen nur aus der Vernunft ergeben. Er argumentiert, dass die Menschen auch moralische Verpflichtungen gegenüber ihren Angehörigen und Gemeinschaften haben. Sandel widerspricht auch der liberalen Ansicht, dass Regierungen Fragen der Moral vermeiden sollten - er meint, die Menschen müssten diese Fragen diskutieren, um die Ziele und Unterschiede ihrer Gemeinschaft zu bestimmen.
Die politische Theorie des Aristoteles: Sandel stimmt zu, dass der Staat den Menschen helfen sollte, ein erfülltes und tugendhaftes Leben zu führen. Im Gegensatz zu Aristoteles lehnt er es jedoch ab, Menschen in bestimmte Rollen zu zwingen und soziale Güter auf der Grundlage von Verdienst und moralischer "Wüste" zu verteilen. Stattdessen glaubt Sandel, dass der Staat Werte wie Verwandtschaft, Solidarität und Bürgerbeteiligung vermitteln sollte, damit jeder frei über die beste und moralischste Art zu leben und soziale Güter zu verteilen diskutieren kann.
Praktische Beispiele: Kommunitäre Projekte
Um zu zeigen, wie der Kommunitarismus in der Praxis funktioniert, gibt Sandel Beispiele dafür, wie Regierungen eine Gemeinschaft von Bürgern schaffen und erhalten können:
1) Märkte regulieren: Sandel glaubt zwar nicht an die Abschaffung des Kapitalismus der freien Marktwirtschaft, aber er schlägt vor, dass die Regierungen die Märkte gründlich regulieren. In einem unregulierten Markt beurteilen die Menschen die Dinge nach ihrem Geldwert oder ihrer Rentabilität und nicht nach ihrem moralischen Wert oder ihrem Wert für die Gemeinschaft. Sandel argumentiert, dass Regulierung andererseits verhindern kann, dass der Kapitalismus der freien Marktwirtschaft die Werte und Traditionen der Gemeinschaft durch das ersetzt, was am profitabelsten ist. Dies verbindet die marktwirtschaftlichen Ideale des Libertarismus mit Aristoteles' Anliegen, die Moral der Bürger zu erhalten und zu fördern.
2) Ungleichheit bekämpfen: Sandel warnt davor, dass wachsende Ungleichheit Gemeinschaften schadet. Zunehmende Ungleichheit bedeutet, dass Menschen aus verschiedenen Schichten und mit unterschiedlichem Hintergrund weniger miteinander interagieren - die Reichen haben genug Geld, um sich von allen anderen abzuschotten. Wenn sich die Wohlhabenden selbst abschotten, tragen ihre Steuern nicht zu den öffentlichen Dienstleistungen in ärmeren Gegenden bei. Diese öffentlichen Dienstleistungen (z. B. Schulen, Parks und Gemeindezentren) sind nicht nur für die Verbesserung der Lebensbedingungen armer Menschen von entscheidender Bedeutung, sondern auch dafür, dass sich verschiedene Arten von Menschen zusammenfinden und ihr Gemeinschaftsgefühl stärken. Dies spiegelt Rawls' Liberalismus wider - insbesondere die Idee, dass wirtschaftliche Ungleichheit nur so lange gerecht ist , wie sie der Gemeinschaft als Ganzes dient (in diesem Fall durch Steuern, die öffentliche Dienstleistungen finanzieren).
3) Förderung der öffentlichen Beteiligung: Sandel schlägt außerdem vor, dass Regierungen die Beteiligung der Öffentlichkeit (durch finanzielle Anreize) fördern oder vorschreiben, z. B. durch Freiwilligenarbeit, gemeinnützige Arbeit oder politische Beteiligung. Öffentliche Partizipation bedeutet alles, von staatlich initiierten öffentlichen Bauprojekten bis hin zu Kampagnen, die Menschen dazu ermutigen, sich politisch zu organisieren. Diese Bemühungen bringen die Menschen nicht nur dazu, mit anderen Mitgliedern ihrer Gemeinschaft in Kontakt zu treten, sondern sie ermutigen die Menschen auch, einander zu helfen und sich an dem größeren Projekt, ein Bürger zu sein, zu beteiligen. Diese Idee steht im Einklang mit dem utilitaristischen Gedanken, da sie die Bürger dazu ermutigt (oder verpflichtet), durch öffentliche Projekte das Wohlergehen so vieler Menschen wie möglich zu maximieren.
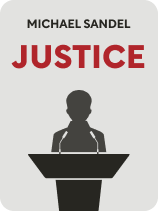
---Ende der Vorschau---
Gefällt Ihnen, was Sie gerade gelesen haben? Lesen Sie den Rest der weltbesten Buchzusammenfassung und Analyse von Michael Sandels "Justice" bei Shortform.
Das finden Sie in unserer vollständigen Zusammenfassung der Justiz:
- Ein philosophischer Blick auf das Ziel unserer Gesellschaft und ihrer Gesetze
- Wie eine moralische und gerechte Regierung und Gesellschaft aussehen
- Sandels Vorschläge, wie eine moralischere Welt geschaffen werden kann