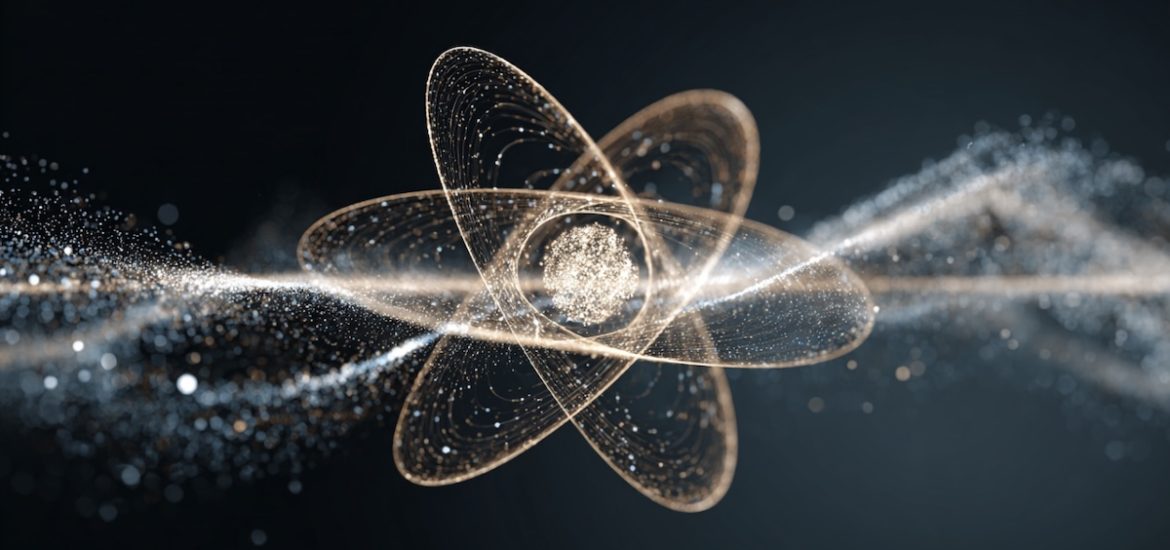Die Quantenmechanik hat eine seltsame Eigenart: Teilchen scheinen unterschiedlichen Regeln zu folgen, je nachdem, ob wir sie beobachten. Dieses Rätsel, das so genannte Messproblem, hat eine jahrzehntelange Debatte darüber ausgelöst, was auf der Quantenebene tatsächlich real ist.
In seinem Buch What Is Real? schreibt der Astrophysiker Adam Becker, dass Physiker sehr unterschiedliche Lösungen für das Messproblem in der Quantenmechanik vorgeschlagen haben - von Paralleluniversen über verborgene Variablen bis hin zur Bewusstseins-Kollaps-Realität. Lesen Sie mehr über dieses grundlegende Rätsel und warum es auch heute noch von Bedeutung ist.
Inhaltsübersicht
Das Messproblem erklärt
Becker erklärt, dass die Quantenmechanik für identische Teilchen zwei verschiedene physikalische Gesetze zu fordern scheint, und welche Gesetze gelten, hängt davon ab, ob jemand zuschaut, wie beim Doppelspaltexperiment. Physiker nennen dies das "Messproblem" - der Akt der Messung scheint die Regeln, die für Teilchen gelten, zu verändern. Daraus ergibt sich ein Rätsel: Wo findet der Übergang zwischen dem einen und dem anderen Regelwerk statt?
(Kurzer Hinweis: Was ist eine "Messung" - und wer gilt in derQuantenmechanik als Beobachter? Die Messung erfordert eine Wechselwirkung, die Informationen über das Quantensystem vermittelt, und diese Wechselwirkung zwingt das System, bestimmte Zustände zu wählen. Beim Doppelspaltexperiment beispielsweise sind es die Detektoren, die mit den Elektronen in Wechselwirkung treten und aufzeigen, welchen Spalt sie passiert haben. Wie Becker betont, gibt dies jedoch ein Rätsel auf: Wenn die Messgeräte ebenfalls aus Quantenteilchen bestehen, warum verhalten sie sich dann nach den Gesetzen der klassischen Physik und liefern eindeutige Ergebnisse? Die Physiker wissen es nicht; sie haben noch nicht definiert , wo die Grenze zwischen der Quantenwelt und der klassischen Welt liegt ).
Schrödinger antwortete mit einem Gedankenexperiment: Man stelle sich eine Katze in einer Kiste mit einem Geigerzähler und einem radioaktiven Atom vor, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % zerfällt und einen Hammer auslöst, um ein Giftfläschchen zu zerschlagen. Die Quantenmechanik besagt, dass das radioaktive Atom in einer Überlagerung von zerfallenem und nicht zerfallenem Zustand existiert. Wenn die Quantenmechanik universell gilt, erstreckt sich die Überlagerung auch auf den Geigerzähler (ausgelöst und nicht ausgelöst), das Fläschchen (zerbrochen und intakt) und die Katze (tot und lebendig). Erst wenn man die Schachtel öffnet, "wählt" alles einen bestimmten Zustand. Schrödinger fand das lächerlich: Katzen sind unabhängig von der Beobachtung lebendig oder tot. Dies zeigte, dass entweder die Quantenmechanik unvollständig war oder die Realität seltsamer war, als man sich vorstellen konnte.
(Kurzer Hinweis: Schrödingers Gedankenexperiment wurde nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1935 jahrzehntelang weitgehend ignoriert, da Wissenschaftler und Philosophen durch die Ungewissheit, die es offenbarte, beunruhigt waren. Die Schriftstellerin Ursula K. Le Guin entdeckte es um 1972 wieder und war fasziniert - ihre Kurzgeschichte "Schrödingers Katze" aus dem Jahr 1974 brachte das Gedankenexperiment in das Bewusstsein des Mainstreams. Le Guin sah eine Verbindung zwischen Fantasy-Literatur und Physik: Beide erfordern die Ablehnung von Erklärungen des gesunden Menschenverstands und eine radikale, sogar phantasievolle Ungewissheit über die Realität. Le Guin argumentierte, dass Fantasie und Wissenschaft die grundsätzliche Bereitschaft teilen, zu hinterfragen, ob die Dinge so sein müssen, wie sie sind.)
Drei Antworten auf das Messproblem
Becker erklärt, dass die Physiker drei Antworten auf dieses Problem entwickelt haben. Einstein und andere Realisten bestanden darauf, dass die Quantenmechanik unvollständig sein muss: dass Teilchen Eigenschaften haben, die die Theorie nicht beschreiben kann. Bohr und die Anti-Realisten vertraten die Ansicht, dass Teilchen erst dann Eigenschaften haben, wenn sie gemessen werden, was Fragen nach der ungemessenen Realität sinnlos macht. Heisenberg, ebenfalls ein Anti-Realist, vertrat die Ansicht, dass Teilchen als "Potentialitäten" existieren, bis sie durch Messung zu tatsächlichen Teilchen werden. Bis 1927 kristallisierten sich zwei konkurrierende Auffassungen heraus: Die Realisten bestanden darauf, dass die Physik eine objektive Welt beschreiben muss, die unabhängig von der Beobachtung existiert, während die Anti-Realisten die Quantenmechanik als ein Instrument zur Organisation von Versuchsergebnissen und nicht zur Beschreibung der Realität betrachteten.
(Kurzer Hinweis: Becker erörtert die Debatte zwischen Realisten und Anti-Realisten darüber, ob die Wissenschaft die Realität beschreibt oder nur unsere Beobachtungen ordnet. Der QBismus, eine radikale Interpretation der Quantenmechanik, legt jedoch nahe, dass diese Debatte am Thema vorbeigeht. So wie die Künstler des Expressionismus zu der Zeit, als die Quantenmechanik entwickelt wurde, die wörtliche Darstellung aufgaben undvon der Darstellung der Objekte, wie sie erscheinen, zum Ausdruck subjektiver Begegnungen mit diesen Objekten übergingen, legt QBIsm nahe, dass die Quantenmechanik eher unsere Beziehung zur Natur als die Natur selbst beschreiben könnte. Dies impliziert, dass wir uns mit der Welt durch Interaktion und Interpretation auseinandersetzen, nicht als unabhängiger Beobachter in der dritten Person).
Antwort #1: Die Quantenmechanik muss unvollständig sein
Einstein war mit der Quantenmechanik unzufrieden, obwohl er zu deren Entwicklung beigetragen hatte. Er wandte sich gegen die Vorstellung, dass die Realität von der Beobachtung abhängt, und war der Meinung, dass die Wissenschaft die Welt so beschreiben sollte, wie sie objektiv existiert. Anhand eines Gedankenexperiments mit zwei kollidierenden Teilchen demonstrierte Einstein, was er als grundlegendes Problem ansah: Die Messung eines Teilchens bestimmt sofort die Eigenschaften des anderen, unabhängig von der Entfernung, doch die Quantenmechanik behandelt das nicht gemessene Teilchen nur als Wahrscheinlichkeitswelle. Dies deutet entweder darauf hin, dass die Quantenmechanik unvollständig ist (es fehlen reale Eigenschaften wie Position und Impuls) oder dass die Natur gegen das Prinzip der Lokalität verstößt - das Prinzip, dass Objekte nur von ihrer unmittelbaren Umgebung beeinflusst werden. Einstein kam zu dem Schluss, dass die Quantenmechanik unvollständig sein müsse, und hoffte, dass künftige Entdeckungen zeigen würden, dass sie lediglich eine statistische Annäherung an eine tiefere, vollständigere Theorie sei, die sowohl die Lokalität als auch die objektive Realität wiederherstellen würde.
Antwort #2: Fragen über die ungemessene Realität sind bedeutungslos
Im Gegensatz zu Einstein gab der Physiker Niels Bohr die Vorstellung auf, dass die Physik die objektive Wirklichkeit beschreiben sollte. Seine Interpretation der Quantenmechanik enthielt zwei Schlüsselideen:
- Komplementarität: Bestimmte Eigenschaften (wie die Natur von Wellen und Teilchen) können nicht gleichzeitig beobachtet werden, obwohl beide Beschreibungen erforderlich sind, um Phänomene vollständig zu erklären.
- Keine unabhängige Realität: Teilchen haben keine eindeutigen Eigenschaften, solange sie nicht gemessen werden, so dass es sinnlos ist, nach ihrem Zustand zu fragen, wenn sie unbeobachtet sind.
Bohrs Ansicht führte zu einer Spaltung zwischen einem "klassischen Bereich" mit realen Messgeräten und -ergebnissen und einem "Quantenbereich", der nur als Mathematik und nicht als unabhängige Realität existierte. Er wies philosophische Fragen über unbeobachtetes Quantenverhalten zurück und vertrat die Ansicht, dass sich die Physik ausschließlich auf experimentelle Ergebnisse konzentrieren sollte. Dieser Ansatz ermöglichte es den Physikern, die Quantenmechanik praktisch anzuwenden, ohne sich mit ihren tieferen Interpretationsproblemen auseinandersetzen zu müssen - sie konnten die Ergebnisse einfach mathematisch vorhersagen, ohne zu fragen, was dies über die Natur der Realität bedeutet.
Antwort #3: Ungewissheit
Heisenberg ging das Messproblem mit seiner Unschärferelation an, die besagt, dass die genaue Messung einer Eigenschaft eines Teilchens (z. B. der Position) eine andere Eigenschaft (z. B. den Impuls) ungenauer macht - und zwar nicht aufgrund fehlerhafter Geräte, sondern aufgrund grundlegender quantenmechanischer Beschränkungen.
Wie Bohr lehnte auch Heisenberg den Realismus ab und behauptete, Teilchen hätten keine eindeutigen Eigenschaften, solange sie nicht gemessen werden. Allerdings wich er von Bohr ab, indem er vorschlug, dass Teilchen zwischen den Messungen als "Potentialitäten" und nicht als Realitäten existieren, während Bohr bestritt, dass zwischen den Messungen überhaupt eine Realität existiert.
Dieses Potenzialitätskonzept warf schwierige Fragen auf: Wie können Teilchen, die nur als Möglichkeit existieren, mit Instrumenten interagieren, um konkrete Messungen zu erzeugen? Wie kann etwas ohne tatsächliche Eigenschaften bestimmte Ergebnisse erzeugen?
Trotz ihrer philosophischen Differenzen kamen sowohl Bohr als auch Heisenberg letztlich zu dem Schluss, dass die Frage, was Teilchen zwischen den Messungen tun, sinnlos ist.
Die Antwort, die die Debatte gewonnen hat
Becker argumentiert, dass die Physiker Bohrs antirealistische Interpretation der Quantenmechanik nicht angenommen haben, weil sie wissenschaftlich überlegen war, sondern aufgrund historischer und institutioneller Zwänge. Die gängige Darstellung, die Physiker hätten auf der Solvay-Konferenz 1927 einen Konsens erzielt, ist irreführend - es gab keine einheitliche Position, sondern nur Widerstand gegen Einsteins Realismus. Was später als "Kopenhagener Deutung" bekannt wurde, war eigentlich eine Sammlung verschiedener antirealistischer Ansichten.
In den 1960er Jahren hatte die Physikgemeinschaft die grundlegenden Fragen zur Quantenmechanik weitgehend aufgegeben und diesen intellektuellen Rückzug fälschlicherweise für wissenschaftlichen Fortschritt gehalten.
| Wie sich wissenschaftliches und moralisches Denken überschnitten Andere Experten stimmen mit Becker darin überein, dass die Kopenhagener Interpretation weniger eine kohärente Position zur Bedeutung der Quantenmechanik als vielmehr eine Koalition der Opposition gegen Einsteins Realismus war. Abgesehen von der Ablehnung von Einsteins Realismus waren sich die Physiker auch in grundlegenden Fragen uneinig: Einige Physiker betonten, dass das Bewusstsein bei der Messung eine Rolle spielen müsse, während andere diese Idee ablehnten. Jim Baggott (Quantendrama) argumentiert, dass die Dominanz des Denkens trotz solcher Meinungsverschiedenheiten eine Kultur der Gleichgültigkeit gegenüber Interpretationsfragen widerspiegelt, insbesondere unter amerikanischen Physikern. Wenn aber Physiker unter Druck gesetzt wurden, Fragen nach dem Realen als unwissenschaftlich zu behandeln, könnte dies auch dazu geführt haben, dass sie es leichter vermieden, die Frage nach dem moralisch Richtigen zu stellen, als der Zweite Weltkrieg die Physik zu einer militärischen Operation machte? Die amerikanische Physikkultur war schon vor dem Krieg pragmatisch und antiphilosophisch. Während des Krieges befassten sich relativ wenige Wissenschaftler des Manhattan-Projekts mit den moralischen Implikationen ihrer Arbeit. Die Ungewissheit über die Bedeutung der Quantenmechanik könnte das Gefühl der moralischen Verantwortung für die materiellen Folgen der Theorie getrübt haben. |
3 Alternative Wege in die Zukunft
Becker erörtert, wie grundlegende Fragen zur Quantenmechanik nach Jahren der institutionellen Unterdrückung wieder auftauchten. Im Jahr 1932 hatte der Mathematiker John von Neumann angeblich bewiesen, dass Einsteins realistische Sichtweise (Teilchen haben vor der Messung bestimmte Eigenschaften) mathematisch unmöglich ist. Im Jahr 1964 stellte John Bell fest, dass von Neumanns Beweis fehlerhaft war, und wandelte Einsteins philosophische Einwände durch "Bellsche Ungleichungen" in überprüfbare Mathematik um - Einschränkungen, die gelten würden, wenn Teilchen vor der Messung bestimmte Eigenschaften hätten. Bell stellte fest, dass die Realität selbst nicht lokal ist; Quanteneffekte können augenblicklich über den Raum hinweg auftreten.
Das Bell'sche Theorem zwang die Physiker zur Entscheidung zwischen der Aufgabe der Lokalität (Akzeptanz sofortiger Verbindungen), der Aufgabe des Realismus (Akzeptanz, dass Eigenschaften erst dann existieren, wenn sie gemessen werden) und der Ablehnung der Vollständigkeit der Quantenmechanik. Verschiedene Interpretationen der Quantenmechanik stellen unterschiedliche Antworten auf diese grundlegende Entscheidung dar, insbesondere hinsichtlich der Frage, was den Zusammenbruch der Wellenfunktion bei der Messung verursacht:
- Bewahren Sie alles, indem Sie die Universen vervielfachen. Die "Viele-Welten"-Interpretation bewahrt sowohl die Lokalität als auch den Realismus, indem sie die Realität weitaus größer macht, als wir sie wahrnehmen - jede Quantenmöglichkeit ist irgendwo real.
- Akzeptieren Sie die Nichtlokalität, und stellen Sie die objektive Realität wieder her. Die "Pilotwellentheorie" geht davon aus, dass Teilchen immer eine bestimmte Position haben und bestimmten Pfaden folgen, die von Pilotwellen geleitet werden, so dass Messungen lediglich bereits existierende Zustände aufdecken, anstatt Möglichkeiten zu kollabieren. Dies beseitigt das Messproblem, erfordert aber sofortige nichtlokale Verbindungen zwischen weit entfernten Teilchen.
- Ändern Sie die Mathematik. Spontane Kollaps-Theorien gehen davon aus, dass Quantenverrücktheiten in großen Maßstäben durch eingebaute zufällige Kollaps-Mechanismen auf natürliche Weise verschwinden, anstatt mysteriöse Messprozesse zu erfordern.
Warum das Messproblem wichtig ist
Becker argumentiert, dass wir das Messproblem nicht ignorieren sollten. Er vertritt die Ansicht, dass es den Kern unserer besten wissenschaftlichen Theorie betrifft. Außerdem könnte es für künftige Durchbrüche entscheidend sein - seine Lösung könnte uns helfen, die Quantenmechanik mit der Schwerkraft zu vereinen und bessere kosmologische Theorien zu entwickeln. Becker ist der Meinung, dass es sich hierbei nicht nur um philosophische Spitzfindigkeiten handelt, die man beiseite schieben kann, sondern um potenziell entscheidende wissenschaftliche Fragen, die die nächsten großen Fortschritte in der Physik ermöglichen könnten.
Weiter erforschen
Um das Messproblem der Quantenmechanik in seinem breiteren Kontext besser zu verstehen, werfen Sie einen Blick auf unseren vollständigen Leitfaden zu Beckers Buch Was ist real?