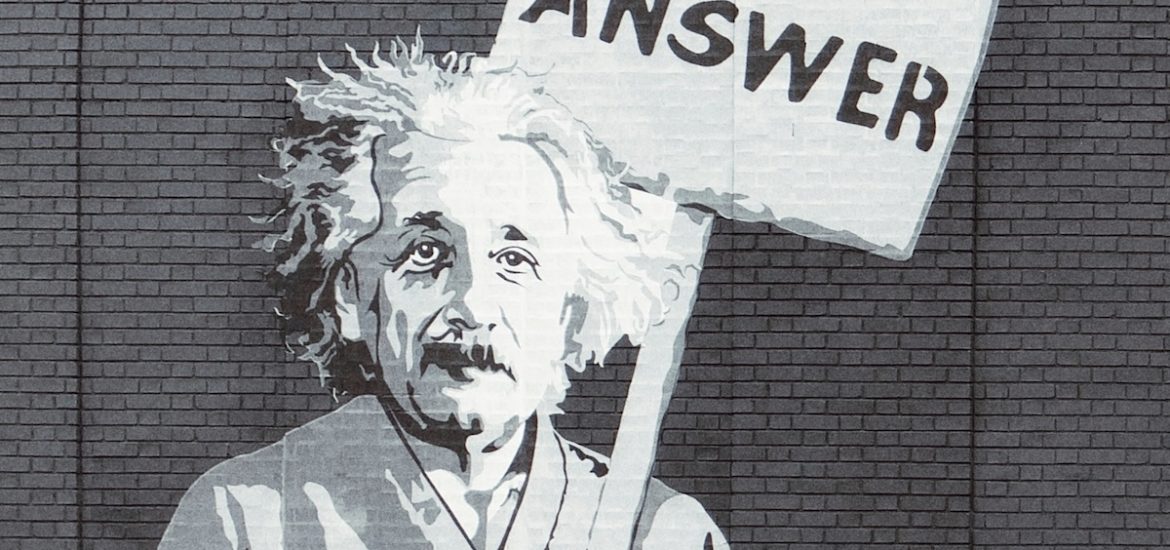Die Quantenmechanik stellte die Physik in den frühen 1900er Jahren auf den Kopf. Die mikroskopische Welt folgte nicht den logischen Regeln, die Wissenschaftler erwartet hatten, sondern offenbarte eine Realität, die unmöglich schien. Hier kommt Albert Einstein ins Spiel. Die Quantenmechanik ist zum Teil auf seine Beiträge zurückzuführen. Dennoch verbrachte er Jahrzehnte damit, gegen die Interpretationen anderer Physiker zu argumentieren.
Bei Einsteins berühmten Debatten mit Niels Bohr ging es nicht um Mathematik oder Experimente. Es ging um etwas Tieferes: darum, was die Realität eigentlich ist und ob die Wissenschaft eine objektive Welt beschreiben oder nur vorhersagen sollte, was wir sehen, wenn wir sie messen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum einer der größten Physiker der Geschichte die revolutionäre Theorie, an deren Entwicklung er beteiligt war, ablehnte.
Inhaltsübersicht
Albert Einstein und die Quantenmechanik
Wie in dem Buch beschrieben Was ist real? von Adam Becker beschrieben, ist die Geschichte der Quantenmechanik eine der tiefgreifendsten intellektuellen Umwälzungen in der Wissenschaft - eine Revolution, die die Physiker dazu zwang, jahrhundertealte intuitive Vorstellungen darüber, wie die Realität funktioniert, aufzugeben. Um die Wende zum 20. Jahrhundert entpuppte sich die mikroskopische Welt als weitaus seltsamer, als sich irgendjemand vorstellen konnte. Sie funktioniert nach Regeln, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen und unsere grundlegendsten Annahmen über die Natur der Existenz in Frage stellen. Diese Veränderung erforderte nicht nur neue experimentelle Techniken oder mathematische Werkzeuge, sondern löste auch eine philosophische Krise aus, die die wissenschaftliche Gemeinschaft in zwei gegensätzliche Lager spaltete.
Im Mittelpunkt dieser Meinungsverschiedenheit stand Albert Einstein. Die Quantenmechanik beunruhigte ihn trotz Einsteins eigener Beiträge zu ihrer Entwicklung zutiefst - nicht wegen ihrer mathematischen Vorhersagen, sondern wegen der Frage, was die Akzeptanz dieser Vorhersagen für die Natur der Realität selbst bedeuten könnte. Seine Einwände sollten die jahrzehntelange Debatte darüber prägen, was die Physik beschreiben sollte: Ist sie die objektive Realität der Welt, wie sie unabhängig von uns existiert, oder lediglich ein leistungsfähiges Instrument zur Vorhersage dessen, was wir beobachten werden, wenn wir hinschauen?
Der Hintergrund der Quantenrevolution
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubten die Physiker, die Grundstruktur der Realität zu verstehen. Doch Atomexperimente erschütterten ihre Grundannahmen und zwangen sie, die Quantenmechanik zu entwickeln - einen neuen Zweig der Physik mit einer neuen Mathematik. Dabei zeigte sich, dass die Bausteine der Natur nach so seltsamen Regeln funktionieren, dass sie unlogisch erscheinen.
Vor dieser Revolution beruhte die klassische Physik auf intuitiven Annahmen, die die beobachtbare Welt erklärten. Physiker betrachteten Atome als winzige Kugeln, die sich zu Verbindungen zusammenschließen und deren spezifische Positionen, Geschwindigkeiten und Energien von den Newtonschen Gesetzen bestimmt werden. Spätere Entdeckungen zeigten, dass Atome größtenteils aus leerem Raum bestehen, wobei die Elektronen einen Kern umkreisen - ein "Planetenmodell", das besagt, dass Atome denselben Gesetzen gehorchen wie Himmelskörper.
Experimente mit Atomen und Licht zeigten jedoch eine radikal andere mikroskopische Welt, in der Energie in diskreten Brocken vorliegt, Materie und Licht sich sowohl als Wellen als auch als Teilchen verhalten und Elektronen nur bestimmte Energieniveaus einnehmen. Die Mathematik, die zur Erklärung dieser Beobachtungen entwickelt wurde, zeigte, dass Teilchen in mehreren Zuständen gleichzeitig existieren und sich über große Entfernungen hinweg gegenseitig beeinflussen können - was der Alltagserfahrung widerspricht.
In seinem Buch erklärt Adam Becker, dass die Quantenmechanik auf identische Teilchen unterschiedliche physikalische Gesetze anwendet, je nachdem, ob sie beobachtet werden - das "Messproblem". Physiker haben drei Antworten entwickelt:
- Albert Einstein und die Realisten argumentierten, die Quantenmechanik sei unvollständig und die Teilchen hätten Eigenschaften, die die Theorie übersehe.
- Niels Bohr und die Realitätsgegner behaupteten, dass Teilchen keine Eigenschaften haben, solange sie nicht gemessen werden, so dass Fragen über die nicht gemessene Realität sinnlos sind.
- Werner Heisenberg vertrat die Ansicht, dass Teilchen bis zur Messung als "Potentialitäten" existieren.
Bis 1927 kristallisierten sich zwei konkurrierende Visionen heraus: Die Realisten bestanden darauf, dass die Physik die objektive Realität unabhängig von der Beobachtung beschreiben müsse, während die Anti-Realisten die Quantenmechanik als ein Instrument zur Organisation von Versuchsergebnissen und nicht zur Beschreibung der Realität betrachteten.
Einsteins realistische Position: Die Quantenmechanik muss unvollständig sein
Einstein hatte zur Quantentheorie beigetragen. Im Jahr 1905 bewies er, dass sich das Licht selbst in diskreten, quantisierten Paketen, den so genannten "Photonen", fortbewegt. Aber er fand die mathematischen Interpretationen anderer Physiker unbefriedigend. Becker erklärt, dass Einstein sich dagegen wehrte, eine Realität aufzugeben, die unabhängig von der Beobachtung existiert. Er war der Meinung, dass die Wissenschaft die Welt so beschreiben sollte, wie sie wirklich ist, und argumentierte, dass die Theorie unvollständig sein muss, wenn die Quantenmechanik Situationen wie Schrödingers Katze beschreibt.
Einstein hat diesen Einwand in einem Gedankenexperiment über zwei Teilchen, die aneinander abprallen, aufgegriffen. Wenn man die Position und den Impuls des einen Teilchens nach der Kollision misst, bestimmt das sofort die Eigenschaften des anderen, unabhängig von der Entfernung zwischen ihnen. Nach der Quantenmechanik kann das andere Teilchen jedoch nur als Wahrscheinlichkeitswelle existieren, bis es direkt beobachtet wird. Entweder hat dieses Teilchen also Eigenschaften (Impuls und Position), die die Quantenmechanik nicht beschreibt, oder die Natur verstößt gegen das Lokalitätsprinzip - dieVorstellung, dass Objekte nur von ihrer unmittelbaren Umgebung beeinflusst werden können. Aus diesem Grund kam Einstein zu dem Schluss, dass die Quantenmechanik nicht die letzte Wahrheit über die Realität darstellen kann.
(Kurzer Hinweis: Das Einsteinsche Lokalitätsprinzip besagt, dass Einflüsse zwischen weit entfernten Objekten den Raum zwischen diesen Objekten durchqueren müssen und dafür Zeit benötigen - wie die Verzögerung zwischen dem Umlegen eines Lichtschalters und dem elektrischen Signal, das eine Lampe erreicht. Die Quantenmechanik sagt jedoch voraus, dass die Messung eines Teilchens sich sofort auf seinen entfernten Partner auswirken kann, so als ob das Umlegen eines Schalters in New York sofort ein Licht in Tokio einschalten könnte, ohne dass eine physikalische Verbindung zwischen ihnen besteht. Abgesehen von dem von Becker beschriebenen Problem war dies auch für Einstein ein Problem, weil es im Widerspruch zu seiner Relativitätstheorie stand, die besagt, dass sich nichts schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen kann).
Einstein glaubte, dass zukünftige Entwicklungen zeigen würden, dass die Quantenmechanik eine statistische Annäherung an eine tiefere, vollständigere Theorie ist. Becker erklärt, dass diese tiefere Theorie nach Einsteins Ansicht sowohl die Lokalität als auch die objektive Realität wiederherstellen und gleichzeitig die praktischen Erfolge der Quantenmechanik bewahren könnte.
| Ist es möglich, eine Theorie von Allem zu finden? Wie Becker erklärt, schwebte Einstein eine einheitliche Theorie vor, die die Konflikte zwischen Relativitätstheorie und Quantenmechanik lösen würde. Die Suche nach einer "Theorie von Allem" fesselt Physiker seit fast einem Jahrhundert, aber einige Wissenschaftler bezweifeln, dass dies ein realistisches Ziel ist. Diese Theorie würde die vier Kräfte vereinen, die alles im Universum bestimmen: den Elektromagnetismus (der die Atome zusammenhält), die starke Kernkraft (die die Teilchen in den Atomkernen bindet), die schwache Kernkraft (die den radioaktiven Zerfall verursacht) und die Schwerkraft. Gegenwärtig erklärt die Quantenmechanik die ersten drei Kräfte, aber nicht die Schwerkraft, die stattdessen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie beschrieben wird. Einstein verbrachte 30 Jahre damit, dieses Ziel zu verfolgen. Aber in Verloren in Matheargumentiert die Physikerin Sabine Hossenfelder, dass die Suche auf einer unwissenschaftlichen Prämisse beruht: der Annahme, dass die Naturgesetze elegant und einheitlich sein sollten, nur weil Physiker solche Theorien mathematisch ansprechend finden. Das Problem ist nicht, dass uns die mathematische Raffinesse fehlt, um die Komplexität des Universums zu erklären, sondern dass wir möglicherweise einer idealisierten Vision dieses Universums nachjagen, die nur eine Illusion ist. |
John Bells Experimente bestätigten und hinterfragten Einsteins Überzeugungen
1964 stellte John Bell den "Unmöglichkeitsbeweis" von John von Neumann aus dem Jahr 1932 in Frage, der jede Interpretation der Quantenmechanik auszuschließen schien, bei der Teilchen vor der Messung bestimmte Eigenschaften haben (Theorien der verborgenen Variablen). Becker erklärt, dass Bell den Beweis für fehlerhaft hielt und einen mathematischen Test - die Bellschen Ungleichungen - entwickelte, um experimentell festzustellen, ob Teilchen bestimmte Eigenschaften haben.
Experimente in den Jahren 1972 und 1982 zeigten, dass verschränkte Teilchen die Bell'schen Ungleichungen verletzen, was beweist, dass die Quantenmechanik eine "spukhafte Fernwirkung" (Nichtlokalität) aufweist - genau wie Einstein befürchtet hatte. Dies zeigte jedoch auch, dass Einstein mit seiner Behauptung, die Quantenmechanik sei unvollständig, falsch lag; der Theorie fehlten keine Informationen, sondern die Realität selbst ist grundsätzlich nichtlokal.
| Warum Bell Einsteins Bedenken für berechtigt hielt Jahrelang lehnten Physiker Einsteins Zweifel an der Quantenmechanik ab und beriefen sich dabei auf von Neumanns Beweis, dass verborgene Variablen unmöglich seien. Dieser Beweis war jedoch fehlerhaft - er stellte die unrealistische Anforderung, dass Kombinationen von Quanteneigenschaften, die nicht zusammen gemessen werden können, dennoch messbar sein sollten, was physikalisch unsinnig ist. Spätere Experimente, in denen die Bell'schen Ungleichungen getestet wurden, ergaben, dass Teilchen eine objektive Realität besitzen (was den Realismus unterstützt), bestätigten aber auch, dass die "spukhafte Wirkung auf Distanz" real ist. Dies bestätigte Einsteins Bedenken: Die Aufgabe der Lokalität - desPrinzips, dass entfernte Orte unabhängig sind - bedrohtunser grundlegendes Verständnis von Ursache und Wirkung. Das Bellsche Theorem bewies schließlich, dass die Quantenrealität tatsächlich so seltsam und beunruhigend ist, wie Einstein vermutet hatte, und zeigte, dass seine Befürchtungen gerechtfertigt und nicht übervorsichtig waren. |
Mehr erfahren Einsteins Meinung zur Quantenmechanik
Um Albert Einsteins Sicht der Quantenmechanik im breiteren Kontext der Debatte zu verstehen, lesen Sie den Leitfaden von Shortform zu Was ist real? von Adam Becker.